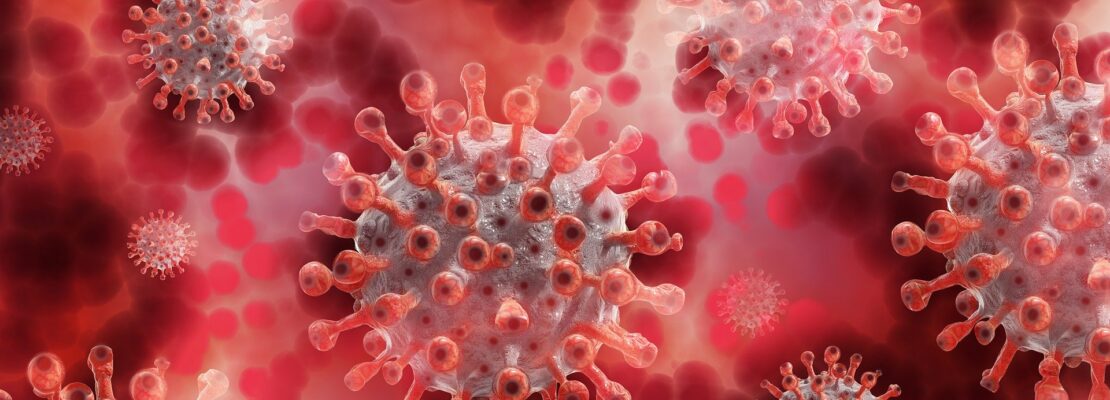von Maik Stöckinger und Renate Breithecker:
Viel wurde bereits geschrieben über Solidarität und Egoismus in Zeiten von Corona. Früh hieß es, dass die Menschen solidarischer würden, weil sie beispielsweise vom Balkon klatschten. Auch über Hamsterkäufe wurde berichtet, die eher für einen größeren Egoismus sprechen. Wir fragen uns, wie es denn um die Solidarität in diesen Zeiten bestellt ist. Wie gestaltet sie sich derzeit aus? Ob und wenn ja: welche Veränderungen lassen sich zur Vor-Corona-Zeit entdecken?
Solidarität vs. Egoismus
Wir nehmen widersprüchliche Signale wahr. Einerseits scheint das Engagement für andere zuzunehmen, wenn wir an Gabenzäune, Maskenbäume oder Nachbarschaftshilfen denken. So machen Gabenzäune das Kümmern um Fremde sehr stark sichtbar, denn an ihnen werden lebensnotwendige Dinge aufgehängt und Bedürftige können sie sich kontaktlos vom Zaun nehmen.
Vielerorts wird berichtet, dass Menschen geholfen wird, denen zuvor nicht geholfen wurde. Solidarität und Hilfsbereitschaft steigen an, man hält zusammen und unterstützt sich gegenseitig. Dazu gehört auch, dass man zugunsten gefährdeter Gruppen auf eigene Freiheiten verzichtet. Andererseits kommt es zu „Hamsterkäufen“ z.B. von Toilettenpapier, Desinfektionsmitteln, Mehl und Hefe, so dass diese Produkte nur in reglementierten Mengen abgegeben werden. Auch Diebstähle von Desinfektionsmitteln und Masken aus Krankenhäusern werden gemeldet, die Notlage wurde sofort in neue Varianten des „Enkeltricks“ eingebaut, im Internet bestellte und bezahlte Masken etc. treffen nie ein. Das deutet auf einen wachsenden Egoismus der Bürger*innen hin.
Bürgerschaftlichen Engagement
Solidarität zeigt sich im bürgerschaftlichen Engagement. In Corona-Zeiten zählen dazu die Nachbarschaftshilfen, das Nähen von Masken und Spendenaktionen für bestimmte Gruppen (Obdachlose, Kulturschaffende, usw.), die durch die Pandemie besonders betroffen sind. Das wird auch in den Medien betont: In den Tagesthemen eine Serie, die sich den „Helden des Alltags“ widmet, in der Lokalpresse eine tägliche Glosse „Die Krise und ich“, die Menschen die Möglichkeit gibt, über ihre Erfahrungen zu berichten. Mit der Gewährung von Hilfen ist auch die Hoffnung verbunden, dass die Engagierten selbst bei Bedarf Hilfe erhalten können – und das ist in Zeiten der Pandemie, die ja jede*n treffen kann, nicht zu unterschätzen. Sehr viele Menschen engagieren sich seit langem im Alltag und tun dies nochmals verstärkt in Krisenzeiten, wie zuletzt der „Lange Sommer der Migration“ und das überwältigende Engagement für Geflüchtete zeigten.
Tücken neuer Rollenzuweisungen
Und doch ist unter Corona-Bedingungen vieles anders, vor allem ältere Engagierte müssen umdenken: Ein schönes Beispiel dafür beschreibt eine junge Hamburgerin, die spontan helfen und für ältere Menschen Einkäufe erledigen wollte. Als sie Flyer verteilte, reagierte eine ca. 80-jährige Frau und fragte, ob sie mithelfen könne. Das wiederum fand die junge Engagierte „absurd“. (Die Zeit, Nr. 14, 26.03.2020) Ähnlich berichtete eine ältere Dame, dass sie beim Einkaufen darauf angesprochen wurde, ob das nicht jemand für sie übernehmen könnte, sie gehöre ja schließlich zur Risikogruppe. Diese Reihe ließe sich fortsetzen, sie macht die neuen Formen der Solidarität, die neuen Rollen und Erwartungen und ihre Tücken im Alltag sichtbar: Die, die bisher anderen viel geholfen haben, sollen nun selbst nichts tun und Hilfe annehmen. Die Beispiele zeigen darüber hinaus, dass die nicht immer freiwillige Solidarität zum Schutz von Risikogruppen mit der Erwartung verbunden ist, dass diese auch gewürdigt und angenommen wird. Die Beziehungen werden dann angespannt, wenn die gewährten Gaben (vor allem der Verzicht auf Freiheiten und die angebotene Unterstützung) nicht mit einem entsprechenden Verhalten (soziale Distanzierung und Dankbarkeit) belohnt werden.
Nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft?
Bezüglich der Frage, ob die Corona-Krise zu wachsender Solidarität in der Gesellschaft beitragen wird, verweisen wir auf das ohnehin große Engagement in unserer Gesellschaft und erwarten perspektivisch eine Anpassung und Normalisierung. Denn irgendwann sind genügend Masken genäht, gehen Menschen wieder arbeiten, sind Freizeitangebote nicht länger geschlossen, haben sich Lieferdienste etabliert und andere Engagementbereiche sind wieder zugänglich. Sicher werden sich Aktivitäten verschieben – darin liegt das Risiko für Organisationen und Initiativen, die auf ehrenamtlichem Engagement basieren. Sie müssen viel daransetzen, ihre Mitglieder „bei der Stange zu halten“, damit diese sich auch nach der Krise weiter engagieren.
Auch die zeitlichen Ressourcen, die aufgrund von Kurzarbeit und vielen geschlossenen Angeboten aktuell recht groß sind, werden sich wieder reduzieren und zu einem Rückgang des Engagements führen. Des Weiteren bedarf das Gewähren von Gaben einer gewissen emotionalen Basis, wie die Erfahrungen u.a. mit Spendenaufrufen belegen, sind diese erfolgreicher, wenn sie mit emotionalen Botschaften, Bildern etc. transportiert werden. Da wir voraussichtlich noch eine ganze Weile mit Corona werden leben müssen, ist anzunehmen, dass die Emotionalität dieses Themas abnehmen wird und damit auch die Bereitschaft zum Spenden. Schon jetzt ist eine gewisse „Genervtheit“ zu beobachten, die solidarischem Verhalten zuwiderläuft.
Vergessen werden darf dabei auch nicht, dass es sich derzeit zu einem Teil um „verordnete“ (erzwungene) Solidarität und um Selbstsorge handelt: Um Risikogruppen zu schützen, bleiben wir zu Hause. Und wir tun dies auch, weil wir uns selbst schützen wollen. Unser Verhalten ist also gleichermaßen egoistisch und solidarisch.